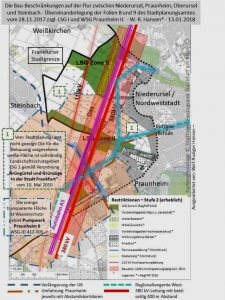Deutschland braucht massenweise neue Wohnungen. Und die Immobilienbranche feuert aus allen Rüsseln der Betonmischer. Bundesweit, so das Unternehmen BNP Paribas Real Estate, seien bereits 7,99 Milliarden Euro in Wohnungsbestände investiert worden – eine Marke, die bisher nur einmal in zehn Jahren geknackt werden konnte.
Insgesamt habe man für die Erhebung „über 80 Deals mit zusammen knapp 64.000 Wohneinheiten“ auswerten können. Dabei habe sich gezeigt, dass der durchschnittliche Preis pro Verkaufsfall „bei gut 96 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum“ gelegen habe. Ein Bombengeschäft.
Aber eine Frage lassen die Geschäftsleute offen. Wie das alles aussieht, was auf diese Weise entsteht, ist dem Branchendienst keine Rede wert. Der Druck, unter dem die Wohnungswirtschaft steht, sorgt dafür, dass es nach Jahren des „schöner Wohnens“ nur noch um Quantität statt um Qualität geht.
Copyright: WELT/Larissa Keller
Anschauungsunterricht dafür bietet in der Tat die neueste Ausgabe des „Deutschen Architektenblatts“ (DAB 05.2018) mit einer Blütenlese jüngster Beispiele neu geschaffener städtischer Wohnkultur. Was diese „Deutschlandreise zu vorbildlichem preiswertem Mietwohnungsbau“ zutage bringt, kann den Freund schöner Neubauten nur erschrecken. Wenn das Zentralorgan der deutschen Architekten meint, mit seiner Auswahl tatsächlich aufzuzeigen, „was derzeit bundesweit möglich ist, ohne an Architekturqualität zu sparen“, dann ist den Baugestaltern jeder Instinkt für die Wohnwünsche breiter Schichten der Stadtbevölkerung abhandengekommen.
Spätestens seit der Internationalen Bauausstellung Berlin 1984/87 weiß man, dass man mit Siedlungen und Gartenstädten keine großstädtische Mitte gestalten kann. Ebenfalls schon 22 Jahre ist es her, dass der deutsche Bauminister Klaus Töpfer von der Habitat-Konferenz aus Istanbul mit der Erkenntnis zurückkam, dass das „Leitbild urbaner Entwicklung“ für Deutschland nur die „Stadt der kurzen Wege“ sein könne – nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus sozialen Gründen.
Denn, so Töpfer: „Geringe Distanzen und Mischung städtischer Funktionen sind eine wichtige Voraussetzung, um soziale Integration und gesellschaftliche Stabilität in den Städten zu gewährleisten.“ 2007 bekräftigten die Europäer dann ihr Bekenntnis zu genau diesem Leitbild in ostentativer Abkehr von der stadtfeindlichen Charta von Athen (1933/44) in der neuen „Leipzig Charta für die nachhaltige europäische Stadt“. Um diesem Klärungsprozess die Krone aufzusetzen, fügten die Deutschen vor einem Jahr dem Baugesetzbuch noch eigens das „Stadtquartier“ als zentralen Stadtbaustein hinzu.
Dem Land droht eine Zerstörungswelle
Und was kehrt davon in den Vorzeigebeispielen der Bundesarchitektenkammer wieder? Nichts. Wenn das repräsentativ für den von der deutschen Bundesregierung mit Milliardenaufwand angeschobenen massenhaften Wohnungsneubau sein sollte, droht dem Land eine Zerstörungswelle wie durch den Wiederaufbau nach dem Krieg.
Die ehrenwerten Erkenntnisse der städtebaulichen und planerischen Forschungsinstitute, die ganze Bibliotheken füllen und den Steuerzahler alljährlich Millionenbeträge kosten – alles Makulatur. Präsentiert wird Siedlungsbau, wie in des seligen Frankfurter Stadtbaurats Ernst May von Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit gebeutelten Zeiten. Aber aus noch so vielen Siedlungen wird keine Stadt.
Das ist keine Frage fehlender Finanzmittel, sondern falscher oder fehlender Konzeptionen. Denn die erst vor hundert Jahren erfundene Siedlung weiß mit den Qualitäten des Städtischen nichts anzufangen. Sie vernachlässigt das, was Städte für Zuzügler attraktiv macht, was gerade deshalb die Preise für Wohnungen in den begehrtesten Vierteln explodieren lässt – mit der schlimmen Kehrseite, dass Altmieter der hoffnungslosen Konkurrenz der neuen Städter ausgeliefert, die Infrastrukturnetze noch mehr ausgeweitet und damit der Ressourcenverbrauch, die Flächenversiegelung, der Verkehr weiter in die Höhe getrieben werden. Keine dieser Einsichten findet in den Vorzeigebeispielen für einen neuen Massenwohnungsbau Berücksichtigung.
Copyright: WELT/Christin Brauer
Sieht man die Beispiele im Einzelnen durch, so fällt die Radikalität auf, mit der dieser neue Städtebau den für die Stadt so wichtigen öffentlichen Raum flächenhaft zerstört. Man setzt nicht auf städtische Bautypologien wie die Blockrandbebauung, sondern erneut auf vorstädtischen Zeilenbau, nicht auf Parzellenbebauung, sondern Kompaktvergabe ganzer Areale an ein und denselben Bauherren, nicht auf die Trennung von öffentlichen und privaten Räumen, sondern auf fließende Räume ohne jegliche Fassung.
Niemand weiß mehr, was an einem Gebäude vorn und was hinten ist, wo eine Straße anfängt und wo sie endet, was ein Eckhaus ist und wo sich ein Platz öffnet, ob man sich im Zentrum oder am Rand befindet. Was da entsteht, sind Wohn- und Schlafregale, die jegliche Ausstattung mit Elementen der Differenzierung, der Hierarchisierung und ortstypischen Qualifizierung vermissen lassen.
Wie hier eine soziale Mischung, erst recht eine Mischung der Funktionen zustande kommen soll, bleibt das Geheimnis der beteiligten Investoren, Wohnungsgesellschaften und Planer. Die tausendfach beschworene, zum Zukunftstyp erhobene „Stadt der kurzen Wege“ – hier ist sie verraten.
Abweisend und unnahbar
„In den Sechzigerjahren,“ so schrieb der große Vordenker einer zeitgemäßen Stadtgestaltung, Josef Paul Kleihues vor nun schon 30 Jahren, habe man nichts als Schlafstädte geschaffen. Er nannte es „typisch für die zwischen Konvention und Moderne schwankende Ratlosigkeit dieser Zeit“. Bei dieser Ratlosigkeit ist der Städtebau wieder angekommen – und damit um ein halbes Jahrhundert zurückgefallen. Wenn Architekten das für beispielhaft dafür erhalten, „wie bezahlbarer Wohnungsbau gelingen kann“, sind die Begriffe für das, was wirklich zeitgemäß ist, verloren gegangen.
In der realen Begegnung mit den neuen Wohncontainern wird sich dem Publikum ein ganz anderer Eindruck aufdrängen. Die als aktuelles Bild einer neuen, auf die Wohnbedürfnisse breiter Schichten ausgerichtete Stadt, die sicher nicht als Landidyll oder Käfighaltung gedacht ist, gibt sich abweisend und unnahbar. Da werden die Sockelgeschosse so hochgezogen, dass sogar noch die Kellerfenster in Kniehöhe aus der Fassade schauen. Da werden die monotonen Fassaden durch schiefsitzende Balkone oder im Zickzack geführte Betongesimse vermeintlich „aufgelockert“, in Wahrheit verkrüppelt.
Da werden meterhohe Betonkästen, in die ein paar Kräuter hineingepflanzt sind, vor die Fassaden gestellt, um den Spaziergänger nur nicht zu nahekommen zu lassen, sondern auf den Gehsteig zurückzustoßen. Da wird das gesamte Erdgeschoss in eine Abstellfläche für Autos umgewandelt, über der dann erst die mit mächtigen Brüstungen wie mit Panzersperren umgürteten Wohngeschosse des beschönigend so genannten „Terrassenhauses“ obendrauf sitzen.
Was solche Objekte mit den Menschen machen, die täglich daran vorbeigehen, scheint nicht ins Gewicht zu fallen. Dort, wo sich das städtische Haus jahrhundertelang zur Straße hin öffnete, wo es mit den Passanten kommunizierte, sie in Geschäfte oder Gaststätten einlud oder mit gepflegten Vorgärten zu beglücken suchte, wendet es ihnen jetzt Verschanzungen und Barrieren zu und glotzt sie aus den Scheinwerfern und Rücklichtern der Pkws von Wohnungsinhabern an.
Für das wichtige Kleingewerbe, den zu neuer Bedeutung gelangten Tante-Emma-Laden, die Kneipe, das Designerbüro, die Hightechschmiede ist in solcher Monostruktur kein Platz mehr. Man könnte meinen, Stadtplaner Architekten und städtische Verwaltung hätten 40 Jahre Städtebaudebatte verschlafen.
Auf den Wohnungsmarkt kann sich das nur verheerend auswirken. Der Druck auf die angesagtesten Stadtviertel wird weiter zunehmen – trotz Mietbremse, Baukindergeld und gezielter Vergabe immer größerer Grundstücke an Wohnungsgesellschaften, die es so preiswert wie möglich machen sollen. Denn die Preise sind eine Sache der Nachfrage, und die Nachfrage gilt nicht den Schrumpfformen des berüchtigten Plattenbaus, wie sie hier wiederauferstehen, sondern den lebensvollen Stadtquartieren mit Nutzungsmischung und kurzen Wegen, wie sie die gründerzeitliche Stadt ihren Bewohnern bis heute anbietet.
Auf eklatante Weise hat das soeben die jüngste, neunte „Konferenz zur Schönheit und zur Lebensfähigkeit der Stadt“ in Düsseldorf bestätigt, das einzige Forum für Architekten und Stadtplaner in Deutschland, auf dem es um mehr als nur um das Bauvolumen geht. An die Spitze hatten die Veranstalter, die Leiter des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst Christoph Mäckler und Wolfgang Sonne, ihre berühmten zehn Grundsätze des Städtebaus gestellt: Engmaschiges Netz, Trennung öffentlicher und privater Räume, Formulierung des öffentlichen Raums durch Fassaden, des privaten Raums durch Höfe, Multifunktionalität, soziale Vielfalt und Integrativität, das Haus (die Parzelle) als kleinster Baustein, Typologien von langfristiger Nutzbarkeit, Quartiere mit Wiedererkennbarkeit, von bautechnischer Solidität.
Dann schloss sich die Kür von sieben Städten an: Dortmund, Freiburg, Regensburg, Bochum, Frankfurt am Main, Paderborn und Köln. Sie sollten am Beispiel jüngster Projekte zeigen, wie sie, jede auf ihre Weise, eine „Heimat Stadtquartier“ gestalten.
War es die falsche Auswahl, ein Missverständnis, ein Versehen? Die Referate der kommunalen Gesellschaften enttäuschten. Kaum eine einzige konnte ein Beispiel präsentieren, das den Anforderungen an einen nachhaltigen, zukunftsfähigen, funktionsgemischten, integrativen Städtebau genügt. Die Projekte, alle auf finanzieller Sparflamme ausgebrütet, zeigten das übliche Klötzchengeschiebe und Bandwurmzeilen auf der grünen Wiese – von den Referenten mit stolz geschwellter Brust präsentiert als „neuer Städtebau“, mit dem die geforderte Billigbauweise realisiert sei.
Wie kann Stadt zur Heimat werden?
Ist es wirklich das, was im Wohnungsbau heute angesagt ist? „Was hier entsteht, ist Siedlung, nicht Stadt“, rügt der Schweizer Stadtplaner Jürg Sulzer. Man könne nicht einfach nur Häuser zusammenschieben. „Stadt funktioniert nur, wenn der öffentliche Raum geplant wird.“ Sulzer verweist auf den übergreifenden sozialen Auftrag des Städtebaus, der in kaum einem der neu entstehenden deutschen Massenquartiere eingelöst sei.
„Wir müssen zur Ensemble-Bildung kommen, Raumgeborgenheit und Identität schaffen, Stadtraum und Baublock miteinander vernetzen. Wir müssen die Zusammengehörigkeit stärken, die persönliche Vertrautheit fördern. Nur so kann Stadt Heimat werden.“
Hatte man nicht genau das schon vor 30 Jahren gewusst? Der Leiter der berühmten „Altbau-IBA“, Hardt-Waltherr Hämer, den viele den „Retter von Kreuzberg“ nennen, hatte am Ende auch der damals als epochemachend gefeierten Bauausstellung bilanziert: „Zu den Vorzügen des Ortes zählt nun – ganz überraschend – auch die alte scheinbar antiquierte Kreuzberger Mischung von Wohnbebauung, Gewerbe- und Fabrikräumen und Remisen. Sie bietet eine nahezu ideale Voraussetzung für Urbanität. Sie erlaubt, dass moderne und traditionelle Lebensformen in Toleranz nebeneinander existieren: Neue Hightech- und Computer-Produktion, qualifiziertes Handwerk. Jeder Block hat seine Individualität. Die bauliche Mischung von Wohnen und Arbeiten in Kreuzberg ermöglicht das Zusammenleben von Jung und Alt, Deutschen und Türken, Handwerk und Hightech – mit kleinteilig organisierten Schulen, Kindergärten, Läden und kulturellen Freiräumen mittendrin.“
Sieht man sich 30 Jahre später an, was die Erben dieser Erfahrungen daraus gelernt haben, vermitteln die Produkte des Baubooms von 2018 ein niederschmetterndes Bild. Das Vertrauen in die Gestaltungskraft der deutschen Architekten ist zerrüttet. Um banalste Renditeprojekte über die Hürden zu bringen, suchen inzwischen immer mehr Stadtpolitiker, kommunale Wohnungsgesellschaften und Privatinvestoren Zuflucht bei Bürgerbefragungen, wo doch für jeden sonnenklar ist, dass aus 500 egoistischen Einzelwünschen, die sich widersprechen, gegenseitig ausschließen oder von vornherein utopisch sind, niemals Stadt werden kann.
Was waren das doch für Zeiten, als es den gründerzeitlichen Bauherren gelang, Millionen vom Land und aus den Ostgebieten in die Städte strömende Landarbeiter und Kleinbauern in den explosionsartig wachsenden Großstädten zu beheimaten! Ohne „sozialen Wohnungsbau“, ohne staatliche Fördermilliarden und ohne einen einzigen „Bürger“ zu „befragen“, haben sie es verstanden, ganze Städte und Stadtquartiere in einem Baustil, einer Qualität und Mannigfaltigkeit zu errichten, die auch noch nach 120 Jahren Staunen erwecken und Wohnungssuchende so begeistern, dass sich die Vermieter vor Wohnungsinteressenten kaum retten können. Was war nur ihr Geheimnis?